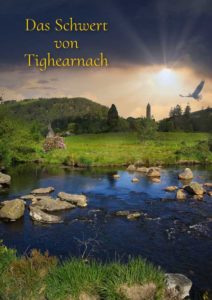»Das Schwert von Tighearnach« spielt in der Hafenstadt Cuanscadan im Süden Erainns.
So, wie Cuanscadan in der Kurzgeschichte beschrieben wird, existiert die Stadt aktuell nicht mehr. Die Ereignisse um den flinken Dieb Airim, um den zwielichtigen Händler Tarloigh, die Diebesgilde, die Schwarzen Schatten (und die Wahren Schwarzen Schatten nicht vergessen!) und Fürst Amhairgin spielen vermutlich um das Jahr 15 ndF.
Diese Kurzgeschichte schrieb ich vor vielen Jahren; sie erschien auch in Follow 372 (2001). Ich habe sie nun leicht überarbeitet und dort für Magira angeglichen, wo es notwendig war. Mag sein, dass mir dabei Details nicht ins Auge fielen – aber auf entsprechende Hinweise ändere ich dies selbstverständlich.
Wer das Quellenbuch »Cuanscadan« zum Rollenspiel MIDGARD kennt, wird einige Orte wiedererkennen. Das ist beabsichtigt, denn Cuanscadan auf Magira und Cuanscadan auf Midgard teilen viele Gemeinsamkeiten – der Fürst ist nur eine von vielen.
Die Kurzgeschichte stelle ich auch als PDF und in den E-Book-Formaten ePUB und MOBI zum Herunterladen zur Auswahl.
ePUB: Das Schwert von Tighearnach
MOBI: Das Schwert von Tighearnach
PDF: Das Schwert von Tighearnach
Das Schwert von Tighearnach
Amhairgin (Karl-Georg Müller)
Grauer, kalter Nebel drückte sich in dichten Schwaden über die Schiffe, die straff vertäut am Kai ruhten. Aus dem nassen Gespinst reckten sich die Masten wie knöcherne Finger empor. Der Vollmond spendete trübes Licht. Das war eine Nacht, in der man die klamme Decke bis zum Hals hochzog und froh war, nicht durch die Gassen zu irren.
Dies war eine Nacht genau nach Airims Geschmack. Der drahtige junge Dieb schob seinen Körper dicht an einen der Lagerschuppen. Selbst unter dem leichten Druck zitterte das klapprige Holzgebäude.
Airim fluchte, der Platz gefiel ihm nicht. Wenn er die Aufmerksamkeit der Stadtwache auf sich zog, die meist zur unpassenden Zeit ihre Runden drehte, warf das seine Pläne über den Haufen. Lieber trieb er sich in den besseren Vierteln der Stadt herum. Es ging doch nichts über eine prall gefüllte Schmuckschatulle im Schlafgemach einer feinen Dame, aus der ihm die Ringe und Armreife entgegen kullerten.
Auf der anderen Seite gehörte er als kleiner Schurke in das Hafenviertel wie ein altes Fischweib auf den Großmarkt. Er war zum Dieb geboren. Er wollte reich werden. Und er sehnte sich nach einem weichen Kissen, auf das er seinen Kopf nach getaner Arbeit legte, und einem knusprigen Braten nach jedem Diebstahl. Am häufigsten träumte er von einem besonderen Mädchen, dem er eines Tages glitzernde Geschmeide zu Füßen legen würde. Wann würde es endlich so weit sein? Er konnte es kaum erwarten …
* * *
Und doch feilschten er und Tarloigh wenige Stunden zuvor verbissen um einen Auftrag.
»Airim«, flüsterte ihm der Händler in der Spelunke Deargrós ins Ohr und kam ihm über den Tisch hinweg so nah, dass der junge Dieb dem fauligen Atem nicht ausweichen konnte, »du weißt, dass meine Auftraggeber immer faire Angebote machen und ich dich niemals übervorteilt oder mit falschen Informationen versorgt habe. Du hast bekommen, was du wolltest. Und nie weniger.«
Tarloigh feixte. Airim war bei dem fauligen Geruch gar nicht zum Grinsen zumute. Die schwarzen Zahnstümpfe ekelten ihn an. Es fehlte nicht viel und er hätte Tarloigh ins Gesicht gekotzt. Airim nahm einen tiefen Schluck aus dem Bierbecher. Er kippte das starke Gesöff so hastig hinunter, dass es über sein Gesicht schwappte. Mit seinem Hemdsärmel fuhr er sich über die Lippen, dann sank er zurück. Er atmete tief durch. In der Kneipe roch es nach fauligem Fisch, dafür schmeckte das Bier besser als in anderen Tavernen. Das linderte seine miese Laune.
»Ihr habt recht, Tarloigh, unsere Geschäfte laufen meistens gut ab. Aber für meine Arbeit verlange ich den Lohn, der mir zusteht, und wir haben beide jedes Mal einen guten Schnitt gemacht. Hören wir besser mit dem Geschwätz auf und reden geradeaus!«
Tarloigh bestellte mit einem knappen Handzeichen zwei neue Trinkbecher. »Du bist ein guter Dieb. Ach, wenn ich ehrlich bin, du bist der beste.« Der Händler strich Airim Honig ums Maul, doch er sah das Blitzen in den Augen des Diebes. »Gut, ich gebe zu, der Auftrag ist der helle Wahnsinn. Aber sag mir, bei welchem Auftrag du dein Leben nicht aufs Spiel setzt? Und wenn du ehrlich bist, so ein kleines Wagnis reizt dich.« Tarloigh blinzelte dem Dieb unter seinen wulstigen Augenbrauen zu.
»Das ist es doch gar nicht!«, stieß Airim hervor. Seine Zähne knirschten, weil er sich nur mühsam im Zaum hielt. Mit beiden Ellenbogen stützte er sich auf dem Tisch ab und kam seinem Gegenüber so nahe, dass der zurückzuckte. »Gefahr, die berechenbar ist, ist das eine. Eine Gefahr, bei der ich nicht einschätzen kann, wie es für mich ausgeht – nein, das hasse ich.«
Bevor er sich in Rage redete, tauchte Einin auf, die junge Schankmaid. Sie setzte zwei randvolle Becher ab. Wie üblich warf sie Airim einen verschmitzten Blick zu, aber der hatte anderes im Sinn und neckte sich nicht mit ihr und tauschte nicht die sonst gewohnten Anzüglichkeiten aus. »Ach, ist der Herr heute nicht gut aufgelegt?«, meinte sie verärgert und wirbelte herum.
Airim konzentrierte sich wieder auf Tarloigh. Der genoss Einins heftigen Gefühlsausbruch und grinste feist. Tarloigh schätzte es, wenn Airim zurechtgewiesen wurde. Das geschah nach seiner Meinung zu selten. Er respektierte diesen Airim, weil er seine Arbeit schnell und gut erledigte. Aber Tarloigh hatte das Gefühl, der junge Rotzbengel halte ihn für einen alten Depp, den man über den Tisch ziehen kann.
»Das Schwert von Tighearnach ist eine von Meisterhand geschmiedete Waffe. Ihr wohnen mächtige Zauber inne, mit denen sich Berge versetzen und Meere erheben lassen. Und der Materialwert bedeutet nichts, verglichen mit dem ideellen Wert, den das Schwert fürs Fürstenhaus besitzt. Tighearnach war ein Vertrauter von …«
Airim winkte gelangweilt ab »Ich weiß.«
Tarloigh verdrehte die Augen. »Lass mich ausreden, auch wenn du nichts Neues hörst. Aber der dumme Tarloigh weiß das eine oder andere, was der schlaue Herr Airim nicht weiß. Und nachher guckt der schlaue Herr dann dumm. Hör mir wenigstens kurz zu. Tighearnach war der Vertraute des Fürsten. Vor vielen Jahren beorderte ihn der Fürst zu einer Mission nach Mallachteara, in das Verfluchte Land. Er wurde von einer Handvoll Fian eskortiert, doch weder Tighearnach noch die Krieger wurden je wieder gesehen. Sie waren verschollen, und niemand erfuhr von ihrem Schicksal. Dass dieses Schwert nach all den Jahren auftaucht, hat mehr als symbolische Bedeutung.«
Airim unterbrach ihn. »Wenn das Schwert wenige Tage nach seiner Entdeckung erneut verschwindet, hetzen alle Schergen des Fürsten hinter mir her. Ich werde meines Lebens nicht mehr froh. So tief kann kein Keller sein, dass der Fürst mich nicht findet.« Bei den letzten Worten hieb er heftig auf den Tisch. Das Bier schwappte aus den Bechern.
»Airim, halt dich zurück«, japste Tarloigh. Sein Blick irrte durch die Kneipe. Hatte ein abgebrühter Gauner wie Tarloigh Furcht? Aber die schummrige Taverne war ein Ort, an dem niemand nach einem jungen Mann schaute, der sich nicht im Griff hatte. »Ich weiß, wie gefährlich die Aktion ist«, flüsterte der Hehler, »aber was bleibt mir, ich will meinen Auftraggeber zufrieden stellen.«
»Erhöht euer mieses Angebot. Zahlt mir 800!« Airim stützte sein spitzes Kinn in die Handfläche und guckte spöttisch. Tarloighs Aussichten waren gering, auf die Schnelle einen anderen mit dem Auftrag zu betrauen, und das wusste der Halunke.
Tarloigh biss die Zähne zusammen. Er nahm einen tiefen Schluck aus dem Becher und stellte ihn bedächtig ab. Er konnte sein Temperament zügeln, sein Geschäft war Verhandeln.
Doch diesmal hielt der Dieb alle Trümpfe in der Hand, er konnte den Preis bestimmen. Deshalb feilschte Tarloigh gar nicht um ein paar Nathrod weniger. »Abgemacht, du sollst die 800 Nathrod bekommen. Nachdem ich das Schwert von Tighearnach in meinen Händen halte.«
Airim grinste breit, offenbar war er sich seiner Sache sicher. Bis zum heutigen Tag hatte er jeden Auftrag erfolgreich ausgeführt, sodass sein Name in gewissen Kreisen der Stadt schon nach wenigen Monden in aller Munde war. Der Nachteil war: die Diebesgilde reagierte unwirsch, wenn Fremde in ihrem Terrain wilderten, ohne sich um Konventionen zu scheren. Er wurde seit einiger Zeit beobachtet. In den letzten Tagen hatten sich zweifelhafte Gestalten an seine Fersen geheftet. »Ihr könnt ja doch über euren Schatten springen, Tarloigh, auch wenn euch dies nicht leicht fällt.«
»Wir haben Glück, das Schwert wird erst morgen an Land gebracht. Du hast genug Zeit, um die Waffe von Bord zu stehlen. Diardagh wird dir am frühen Nachmittag einen Plan vom Schiff bringen. Wenn ich allein an die Kosten für die Karten denke! Also treib mich nicht in den Ruin und bring mir das Prunkstück, sonst …«
Den Rest des Satzes schluckte er zusammen mit einem letzten Schwall Bier hinunter. »Und eins noch. Das Schwert wird morgen um die Mittagsstunde bei einer Feierlichkeit in der Burg dem Fürsten überreicht. Wenn das passiert, bekommen wir die Waffe nicht mehr in unsere Hände. Und jetzt wünsche ich dir Nathirs Segen.« Tarloigh stemmte seinen schweren Körper hoch und wankte zum Tresen. Der letzte Schluck Bier war offenbar zu viel.
Airim ging die kommende Nacht durch den Kopf. Das Schwert befand sich an Bord der Flaíth na Cuanscadan, dem Prunkschiff der Stadt. Brionagh, der Kapitän des Schiffes, hatte für die Rückkehr des Schwerts gesorgt. Seit Tagen kursierten die wildesten Gerüchte über die Umstände des Fundes, schließlich konnte niemand mehr die Wahrheit von Schönfärberei unterscheiden. Eine Kunde aber war verlässlich. Brionagh hatte einen Handel mit dem Kaufmann eines fernen Landes geschlossen und gelangte in den Besitz des Schwerts von Tighearnach. Zudem war die Rede von Zauberei und grausam verstümmelten Opfern unter der Schiffsbesatzung. Und das Schwert sei für immer verflucht und verdamme alle zum Tod, die es anfassten.
Von Zauberei ließ sich Airim beeindrucken. Zauberei machte einen Auftrag unberechenbar und gefährlich. Er scheute nicht die Konfrontation mit menschlichen Gegnern, denn die waren ihm in nichts voraus. Doch Zauberkundige zählte er zu einer besonderen Spezies. Diese dunklen Ängste, die mit den arkanen Künsten verknüpft waren, hatten ihren Ursprung in seiner Kindheit. Damals lebte er in dem kleinen Dorf Daingeann.
Sein Heimatdorf lag etwa siebzig Kilometer flussauf, wo der Runan sich in einer Senke weit ins Land ergoss. Einträgliche Felder kennzeichneten die Ebene, die bekannt war für ihre üppigen Ernten. Seit vielen Jahrhunderten lebte dort ein Menschenschlag, der keine Entbehrungen wie in den ausgetrockneten Bergen im Westen kannte. Alles war beschaulich und genau der Platz, an dem Kinder wie Airim behütet heranwuchsen.
Wie eine Flutwelle brach der Überfall einer Horde Krieger des Clanns der Corco Láigde über das kleine Dorf herein. Die Horde metzelte alle Männer des Dorfes nieder. Am schlimmsten aber wütete ein spindeldürrer, geifernder Magier. Eben noch hatte Airim seine Schwester Taira ausgelassen geneckt. Zusammen mit Taira und anderen Kindern sprang er dem bunten Stoffball hinterher, den sie in eine flache Grube warfen. Gemeinsam mit ihnen feierte Airim seinen Geburtstag. Doch auf einen Schlag war das vergnügte Spiel zum Ende gekommen.
Dem zierlichen Jungen tropfte der Angstschweiß in die Augen. Mit einem Sprung brachte er sich hinter einem Holzverschlag in Sicherheit. Er zitterte am ganzen Leib. Seine Schwester schrie herzzerbrechend. Sie wurde von einer lodernden Feuerflamme erfasst und zu Boden gerissen. Der Magier stieg über ihren verbrannten Körper hinweg wie ein Stück Vieh.
Der kleine Junge vergaß alle Angst und rannte zu ihr. Der Qualm der brennenden Holzhäuser trieb ihm die Tränen in die Augen und der Gestank von verkohlten Menschen drückte ihm auf die Lungen. Er würgte. Trotzdem kniete er sich neben seine sterbende Schwester. Mit den Fingern strich er ihr über die Haare. Dann tupfte er ihr dreimal auf die Nase, wie sie es vor dem Schlafengehen immer gemacht hatten. Sie öffnete ein letztes Mal ihre Augen, die ihn früher ein wenig überheblich – die ältere Schwester eben –, aber doch liebevoll angeschaut hatten. Taira flüsterte seinen Namen, und es war nur noch das Wehen des Windes in einer finsteren Nacht: Airim.
Dann starb sie.
Sein letzter Blick in ihre ängstlich aufgerissenen Augen trieb ihn noch heute oft aus dem Schlaf.
Bevor er sich weiter in trüben Gedanken verlor, schüttete der junge Dieb den Rest des Gebräus hinunter. Er raffte seinen dunkelgrauen Mantel zusammen und nickte dem Wirt zum Abschied zu.
Draußen erwartete ihn gleißendes Sonnenlicht. Dieser Frühlingstag verhieß Fröhlichkeit und Wärme. Airim atmete tief ein und nahm die vom Fluss wehende frische Brise auf. Mit einem eleganten Schlenker warf er sich den Mantel über und eilte davon. Sein Weg führte ihn schnurstracks in seine Unterkunft. Er hatte bei Caronn, einem reisenden Kaufmann, vor wenigen Monden ein bescheidenes Zimmer in einem Hinterhaus angemietet. Für ein paar Münzen bot es ihm genau das, was er für seine Bedürfnisse brauchte: Schutz vor den Augen neugieriger Nachbarn. Caronns Spitzname »Klimper« verwies auf das immer prall gefüllte Geldsäckchen an dessen Gürtel. Der Händler erledigte seine Geschäfte meistens außerhalb von Cuanscadan und kümmerte sich nicht um die Belange seines Mieters, solange der nur pünktlich am Ersten des Monds zahlte.
Airims Behausung war ein düsteres, geducktes Zimmer. Das Inventar beschränkte sich auf das Nötige. In der rechten Ecke moderte seine Schlafstatt vor sich hin, ein wurmstichiges Holzgestell mit einer durchgelegenen Strohmatte. Aber aus seinem Heimatdorf kannte er es nicht anders. Daneben buckelte sich ein Eichentisch, die Oberfläche verzogen durch die Feuchtigkeit und übersät mit Kerben. Vermutlich hatten da schon Airims Vorgänger ihre stümperhaften Schnitzkünste hinterlassen. Die beiden wackligen Stühle rundeten das Bild einer schäbigen Unterkunft ab. Der von einem echten Handwerker geschreinerte Geräteschrank dagegen passte nicht zu den übrigen Möbeln. Airim hatte sein bestes Möbelstück nach seinen genauen Vorgaben fertigen lassen. Der Schrank wurde mit einem speziellen Schloss geschützt, das mit dem üblichen Einbruchswerkzeug nicht geöffnet werden konnte.
In die Innenseite seines Mantels hatte Airim eine Tasche einnähen lassen, die mit einem Band gesichert wurde. In der Tasche steckte der Schlüssel zum Schrank. Bevor er den Schlüssel herauszog, schaute der kleine Dieb durch das Fenster, aber der schmale Innenhof lag verlassen im Schatten. Es hätte ihn misstrauisch gemacht, würde eine Menschenseele in dem schwer zugänglichen Hinterhof herumstreunen. Dorthin hatte außer ihm nur der Hauswirt Zutritt, doch der war vor zwei Tagen abgereist.
Das Schloss schnappte wie einige Male zuvor erst nach einem Fluch und einem energischen Drehen des Schlüssels auf. Vor einem guten Mond wurde ihm der Mechanismus von Nemogh, dem leicht verwirrten Gelehrten, als spektakuläre Erfindung angepriesen. Doch schon nach kurzem Gebrauch knirschte das Metall bei jeder Schlüsseldrehung. Mittlerweile rechnete er täglich damit, das kostspielige Gehäuse wegwerfen zu müssen, weil es seinen Dienst quittierte.
Auf den Regalbrettern hatte er alles deponiert, was er bei seinen Diebeszügen brauchte. Das reichte von den gebräuchlichen Dietrichen aus Eisen über spezielles Schuhwerk bis hin zu Kletterhaken und den eigens gewobenen Seilen aus Slabhraluibh, dem im Roten Land im Westen von Cuanscadan gedeihenden Fesselkraut. Die Frauen der dort lebenden Huahahatschis verwoben die gelben, aufgefasert langen Fäden miteinander. Daraus arbeiteten sie ein äußerst strapazierfähiges, leichtes Geflecht, das sich wegen seiner groben Struktur zwar nicht für Kleidung, aber für belastbare Materialien eignete.
Airim griff nach seinem besten Seil, das mit Schnapphaken versehen war, da ertönte ein kurzes Klopfen an der Tür. Einen Wimpernschlag später sprang die Tür auf, und ein schlaksiger blasser Junge mit gerötetem Gesicht stürzte herein.
»Kannst du nicht warten, bis ich dir das Eintreten gestattet habe!«, schnauzte Airim. Hastig stopfte er das Seil zurück an seinen Platz, dann warf er die Schranktür wütend zu. Diardagh schaute wie immer, wenn er einen Fehler gemacht hatte, betreten zu Boden. »Verzeih, aber Tarloigh hat mich so gehetzt«, stotterte der Junge, der schweißnass war wegen der Anstrengung. Mit dem rechten Fuß scharrte er auf dem Boden, als wolle er am liebsten kehrtmachen.
Doch Airim hielt ihn auf. »Ach, gib die Karte schon her.« Er streckte dem verdatterten Jungen die Hand entgegen. Diardagh kramte in seinem Mantel, brachte aber nichts zum Vorschein.
»Lass mich suchen!«, sagte Airim, der sich die rechte Manteltasche vornahm. Mit einem gezielten Griff in die Tasche zerrte er eine schmale Papierrolle hervor, die mit einem Siegel verschlossen war. »Da haben wir sie. Aber das Siegel ist ja eingerissen.«
Airims Stimme wurde eine Spur schärfer.
Diardagh schaute mit großen Augen zuerst auf Airim, dann auf die Papierrolle. »Das – das muss ich euch erklären. Tarloigh hat mir das da gegeben und ich wollte mich – also – gerade auf den Weg machen, da rief er mich zurück. Er sagte mir: ›ich hab was vergessen‹, und dann sagte er mir: ›Gib die Rolle nochmal her.‹ Dann brach er das Siegel auf und kritzelte was auf die Innenseite, ich konnt aber nichts erkennen.« Diardagh setzte wieder seine Jammermiene auf. »Lesen kann ich doch nicht. Dann schob Tarloigh mir die Papierrolle wieder hin und befahl, dass ich euch auf der Stelle aufsuche. Am Siegel hat er nichts mehr gemacht. Und ich natürlich auch nicht! Vielleicht hat er es vergessen, weil er sich beeilen musste?«
Diardagh schwitzte, ihm rannen glitzernde Tropfen von der Stirn in die dunklen Augenbrauen und weiter in die blinzelnden Augen. Airim starrte ihn abschätzend an.
Was sollte die Geschichte? War diesem Diardagh zu trauen, oder hatte er selbst in die Karte geschielt, um seine Neugier zu stillen. Und wenn ja, was bedeutete das für seine Aufgabe? Stellte das eine zusätzliche Unsicherheit dar?
Airim malte sich aus, wie Diardagh auf dem Nachhauseweg von einem Lehnsmann des Fürsten angehalten wurde und wie er seine Lebensgeschichte herausplauderte. Er sah sich für einen Augenblick vor dem Fürsten knien, der ihm eine Kerkerhaft bei Wasser und Hering androhte. Wenn er aber diesen Tölpel Diardagh betrachtete, der dumpf vor ihm stand und an die Decke stierte, dann klang die Geschichte schon wieder glaubhaft. Diardagh war doch gar nicht fähig, sich eine Geschichte auszudenken. Es musste stimmen, und die Gefahr war gering, dass ein Junge wie Diardagh aufgegriffen wurde.
»Hier, nimm den Seamar, und jetzt mach dich davon!«
Der Junge fingerte nach der Münze, verabschiedete sich mit einem hingehuschten Kopfnicken und rannte aus dem Zimmer, als liefe er um sein Leben. Die Tür knallte laut zu.
Airim rief ihm ein »Elender Strolch« hinterher.
Der Dieb setzte seine Vorbereitungen fort. Aus dem Schrank griff er einen schwarzen Lederrucksack, in den er das ausgewählte Seil stopfte. Sorgfältig steckte er in die beiden Innenfächer seine kleine Sammlung an Dietrichen. Die eine oder andere Tür auf seinem Weg zum Diebesgut musste er sicher aufknacken.
Airim hielt inne. Auf das Schiff kam er nicht so ohne Weiteres. Das war nichts Ungewöhnliches, denn Zäune, Hauswände oder Felsen waren von einem Dieb immer zu übersteigen oder zu erklimmen. Doch ein Schiff war noch nie sein Ziel. Da lag es auf der Hand, dass er mit dem nassen Element Bekanntschaft machen könnte. Und deshalb war so wenig Gepäck wie möglich lebenswichtig, das Gewicht spielte eine Rolle, sollte er sich im Wasser wiederfinden. Zu viel Ballast zöge ihn in die Tiefe.
Airim verzichtete auf Utensilien, die er zwar für nützlich hielt, aber nicht unbedingt brauchte. Er prüfte das Gewicht des Rucksacks – leicht, wie gewünscht, und unauffällig durch den wenigen Inhalt – und stellte ihn bis zum Aufbruch in den Schrank.
Die Sonne stand knapp über den flachen Häuserdächern im Wes, wenige Stunden weiter, und es war stockfinster in Cuanscadan. Dann würde er sich auf den Weg machen. Er wollte zeitig aufbrechen. Die Hafenwache hielt seit den Überfällen des Clanns der Corco Láigde jede unbekannte Person zu später Stunde an und kontrollierte sie vom Scheitel bis zur Sohle. Aber nach dem Dunkelwerden schlenderten in den Hafenvierteln unzählige Seeleute umher, die meisten johlend oder sturzbetrunken oder beides. Sie verstopften die engen Gassen und pöbelten jeden an oder reiherten einem vor die Füße. Dagegen erregte ein junger Erainner wie Airim in dem Gedränge keine Aufmerksamkeit.
»Es ist Zeit, mir die Botschaft des Gauners anzuschauen.« Airim sprach mit sich selbst. Das hatte er sich mit der Zeit angewöhnt. Ein Zeichen seiner Einsamkeit? Er legte die sorgfältig gezeichnete Karte auf den Tisch. Die Papierrolle enthielt die Abbildung des Schiffs, das in wenigen Stunden der Schauplatz seines Diebstahls sein würde.
Tarloigh hatte nicht zu viel versprochen, eine geschickte Hand hatte die Flaíth na Cuanscadan detailliert gemalt. Der nur leicht gebauchte V-förmige Rumpf bot Mannschaftsräume unter Deck, zwei an der Zahl, daneben drei Lagerräume, alle dicht über dem Kiel. Vor dem Achtersteven entdeckte er die Kapitäns- und die Offizierskajüte, von den Außenmaßen her nicht kleiner als eine der Kajüten für die gemeinen Seeleute.
Das Vorderkastell beherbergte Kombüse und Messe für die Mannschaft, und diente als exponierte Stellung für die Elitebogenschützen. Die gegnerische Besatzung wurde durch die schauerliche Galionsfigur eingeschüchtert, die ihnen bei einem Frontalangriff mit ihrem weit aufgerissenen Schlangenmaul und dem Eisendorn, einer gut einen Meter langen blutroten Eisenzunge, entgegen stürmte.
Die Flaíth na Cuanscadan war ein außergewöhnliches Schiff, das nur wenig Ähnlichkeit mit den schlanken Langschiffen der erainnischen Flotte besaß. Das Schiff verfügte neben dem obligaten Großsegel über ein Vorsegel und einen Besanmast. Unter voller Takelage konnte dadurch die Geschwindigkeit eines pfeilschnellen Langschiffes erreicht werden, doch bei guter Windlage segelte die Flaíth na Cuanscadan jedem anderen Schiff mühelos auf und davon.
Mit einem Aufschrei fuhr Airim von der Karte hoch, seine Arme wurden taub, und in seine Brust stach ein Schmerz wie von tausend kleinen Nadeln. Gaeldannach! Verdammt, er hatte das Traumkraut zuletzt vor zwei langen Tagen geraucht. Durch die Vorbereitungen hatte er das leichte Kribbeln und die nervösen Herzschläge übergangen. Jetzt bezahlte er dafür, und es würde nicht lange dauern, dann lag er mit gelähmten Gliedern auf dem Boden.
Seitdem ihm ein Freund vom Traumkraut und seinen Vorzügen in jenen fernen Tagen in seinem Heimatdorf erzählt hatte, gab er sich der betörenden Wirkung hin. In der ersten Zeit nutzte er das Traumkraut, um den Tod seiner Schwester erträglich zu machen. Später half ihm das Kraut, die Wahrnehmungsfähigkeit zu erhöhen, um bei seinen Diebestouren gefeit gegen Überraschungen zu sein. Doch längst verfluchte er das Traumkraut, dessen geringster Nachteil die endlosen Kopfschmerzen waren. Die waren nur der Anfang, später würden Schüttelfrost und Gliederstarre folgen. Und eines Tages würde der Wahnsinn seinen Verstand verschleiern.
Eine Bodendiele unter der Bettstatt war lose eingelegt, darunter verbarg Airim eine Handvoll Traumkraut. Mit zitternden Fingern maß er eine Portion ab und stopfte seine Pfeife. Eiskalter Schweiß rann ihm über die Stirn, sein Schädel dröhnte. Hatte er zu lange gewartet und konnte sich nicht mehr konzentrieren? Er musste in Zukunft achtsamer mit seinem Körper umgehen.
Endlich züngelten kleine Flammen aus der Pfeife, die sich bald in blassgraue Wölkchen verwandelten. Mit einem Seufzen sog Airim eine tiefe Prise ein. Zwei weitere kräftige Züge, und sein Herz schlug wieder regelmäßig. Langsam klangen die Schmerzen ab. Erschöpft sank Airim auf sein Bett.
* * *
Hörte er nicht ein Kratzen an der Tür? Wie viele Stunden waren vergangen, seitdem er das Traumkraut geraucht und seine Kraft mit der Zeit wiedergewonnen hatte? Langsam öffnete er die Tür. Im spröden Holz steckte ein gefaltetes Blatt Papier.
Er schüttelte den Kopf. Traumkraut qualmen und alles um sich vergessen, dass er die Schritte im Hof nicht hörte – das durfte ihm nicht passieren. Er faltete das Papier auseinander und las. Der Brief stammte von Einin.
Mein Liebster!
Du warst heute unausstehlich. Ich weiss deshalb, dass Du wieder einen gefaehrlichen Auftrag angenommen hast. Deshalb habe ich gleich die Runen geworfen, auch wenn Du das als Weibshexerei abtust. Ich will dir nicht alle Zeichen erklaeren, die sich dartaten, aber von der Zielrune und deren Deutung berichte ich Dir.
Die Rune Eiwaz habe ich geworfen. Das bedeutet, dass wieder einmal Du selbst es bist, der sein Schicksal in die Hand nehmen kann. Eiwaz stellt den Weltenbaum dar, das ordnende Prinzip, um das sich unsere Schoepfung rankt. Gib Dich nicht mit vordergruendigen Erklaerungen zufrieden. Es kommen Offenbarungen auf Dich zu, wenn Du sie zu erkennen weisst, oder Taeuschungen, wenn Du Deine Augen verschliesst.
Ich flehe Dich an, seit bitte vorsichtig, denn sowohl Erfolg als auch scheinbares Gelingen kreuzen Deinen Weg. Sei Dir der Kraft des Weltenbaums bewusst, denn nur so wirst Du Deinen Weg bestimmen koennen.
Das, mein Liebster, erzaehlte mir die Letzte der Runen, und Du weisst, dass Deine Nathir allgegenwaertig ist, auch in diesen Runden, die Dir nichts bedeuten.
Weise meine Mahnungen nicht einfach ab. Ich liebe Dich auf immer und ewig, und ich hoffe, Du vergisst das niemals. Nur Du machst mir das Leben in dieser Spelunke ertraeglich, und nur meine Hoffnung auf eine bessere Zeit mit Dir laesst mich Tag fuer Tag mit diesem boesen Wirt und seiner gehaessigen Frau zusammensein.
In Liebe
Deine Einin
Airim legte den Brief auf den Tisch. Seine Einin schrieb ihm. Seit den Tagen, als ihr Vater – ein umtriebiger Seemann, der jedes Rumfass bis zum Boden leer saufen konnte – tot von einer Fahrt zurückgebracht wurde, machte sie ihr weiteres Schicksal vom Werfen dieser Runentafeln abhängig. Die Mannschaft hatte ihrer Familie einen Seesack ausgehändigt, der in einem separaten Schächtelchen einen Stapel Runentafeln barg. Das hölzerne Behältnis trug die Aufschrift: Für meine kleine Einin. »Aus Waligoi«, knurrte der Steuermann des Schiffes. »Wenn du mehr wissen willst, frag Thorgrim, er wirft die Runen!«
Und Einin hatte diesen Thorgrim auf der Seezunge über die Runen ausgequetscht, bis der jammernd mit den Händen rang und bat: »Du weißt alles, Einin, Du wirfst die Runen mit einer Begabung, die ich nicht habe, und kannst sie deuten wie ein echter Wali. Geh und wende Dein Wissen an!«
Und seit diesem Tag legte Einin ihr Schicksal in die Hände der Runen.
Airim war kein Wali, Runen waren ihm suspekt. An Nathir glaubte er, und dieser verdankte er die Wege, die sie vorgezeichnet hatte. Was sollte das Gerede von »Offenbarung« und »Täuschung«. Das Traumkraut würde ihn schon davor bewahren, einer Täuschung zu erliegen. Und seine Augen würde er offen halten. Nein, täuschen konnte man ihn nicht.
* * *
Jetzt, nachdem vollkommene Dunkelheit sich wie eine dichte Decke über die Häuser geworfen hatte, presste er sich an die Hauswand, den Rucksack fest umgeschnallt, den Atem angehalten. Er horchte in die Stille. Durch den Nebel schoben sich die Umrisse der Flaíth na Cuanscadan, die am Kai wie ein imposanter Berg aufragte.
Doch was war das? Zur Rechten huschte eine schmale Gestalt über den Kai in Richtung Schiff. Mit einer Hand umklammerte sie ihren grauen Überwurf. Was sie in der anderen Hand hielt, die sie mit dem Überwurf bedeckte, erkannte Airim nicht. Dann tauchte die Gestalt ein in den wabernden Nebel, und ihre Schritte verwehten. War das ein Seemann, der sich zu später Stunde an Bord stahl?
Airim fluchte. Wenn ein Seemann ihn am Prunkschiff anquasselte, weil er dort herumstrich, dann war alles verloren. Auf einen offenen Kampf mit einem alten Haudegen durfte er sich nicht einlassen.
Er musste schnell zum Heck der Flaíth na Cuanscadan. Vorsichtig setzte er einen Fuß nach dem anderen, die Gurte des Rucksacks packte er mit beiden Händen, damit er nicht verrutschte. Sein Blick wanderte von den altersschwachen Häusern auf der rechten Seite zum langsam näherkommenden Schiff zur Linken.
Es war still. Der Nebel gesellte sich wie ein stummer Begleiter an seine Seite und schluckte die wenigen Geräusche, die seine nackten Sohlen verursachten, und machte ihn unsichtbar.
Ungestört erreichte Airim die Flaíth na Cuanscadan. Da stand er erst einmal mit großen Augen. Wie an einer Felswand kletterte sein Blick Schritt für Schritt am Achtersteven hoch. Bis zur Heckbordreling schätzte er mehr als sechs Meter ab, darunter drängte sich die Achtergalerie mit der Kajüte des Kapitäns. Dort würde er das Schwert von Tighearnach finden.
Die Nebelschwaden rissen für einen Moment auf, die Fenster der Kapitänskajüte schälten sich als kleine Vierecke heraus. Das rechte Fenster war nicht verschlossen. In der Kajüte flackerte Licht.
Airim grinste und hätte am liebsten vor Glück losgelacht, aber er riss sich zusammen. War da etwas inszeniert worden, um den erstbesten Dieb in eine Falle zu locken? Wiegte sich die Besatzung in Sicherheit und hatte die Wachsamkeit über Bord geworfen? Oder war das Schwert längst nicht mehr an Bord?
Den Häschern des Fürsten wollte er nicht in die Arme laufen: Dreh um und hau ab! Dagegen sprach, dass er jeden Auftrag beendet hatte. Sollte sich sein Versagen herumsprechen, war sein tadelloser Ruf ruiniert. Und Gerüchte verbreiteten sich in Cuanscadan schneller als eine Seuche.
Airim zerrte das leichte Seil aus dem Rucksack. Er wickelte ein gutes Stück auf, bis der Haken locker herab baumelte. Mit Schwung trieb er das Gewicht hin und her, maß die Distanz aus den Augenwinkeln, und schleuderte den Haken in die Höhe. Das Seil rollte sich auf. Zu kurz bemessen. Schnell ließ er ein Stück Seil nachlaufen. Dann scharrte Eisen über Holz, bis es sich an der Reling festbiss.
Zwei, drei Rucke am Seil: Es hielt. Den Rucksack legte er sich um und packte das Seil mit seinen Händen. Mit den Füßen drückte Airim sich von der Kaimauer ab, sachte nur, denn der Abstand zur Bordwand war kurz. Seine nackten Sohlen dämpften das Geräusch, als er mit beiden Füßen dagegen stieß.
Mit ein paar schnellen Armzügen robbte Airim das Seil hinauf, bis er knapp unterhalb des Fensters anlangte. Ein letzter Griff, dann sollte er den Fensterrahmen vor sich haben.
»Hey, Maywen, ist er platt?«
Eine junge Stimme in der Kajüte, die verdächtig nach Diardagh klang.
»Sag meinen Namen nicht, du Trottel!«, kam es zurück. Das war eine Frau, sicher diese Maywen. »Natürlich ist er betäubt, das Amulett wirkt sofort, frag nicht so dumm. Und jetzt nimm endlich das Schwert aus der Halterung.«
Airims Mund schnappte auf und zu wie bei einem Fisch an Land. Es fehlte nicht viel, und er hätte vor Wut losgebrüllt. Diese Frau musste die schlanke Gestalt vom Kai sein. Und ihre Stimme kam ihm bekannt vor. Der Name dieser Frau lag ihm auf der Zunge …
Die beiden pfuschten ihm ins Geschäft und besorgten seine Arbeit. Jetzt fiel ihm ein, woher er den Namen Maywen kannte. Hinter der Frau steckte die Diebesgilde. Maywen war diejenige, mit der er sich vor Monden angelegt hatte, als er sich vehement gegen eine Aufnahme in die Diebesgilde wehrte. Nun hatte die Bande Wind vom Schwert bekommen und kam ausgerechnet ihm in die Quere. Und wenn dieser Diardagh wirklich dabei war, dann …
Ein Klopfen an der Kajütentür, eine laute, raue Stimme: »Seid ihr wach, Käpt’n?«
Schnarchen drang nun durch das Fenster, sicher vom betäubten Kapitän.
Die Kajütentür öffnete sich mit einem Knarren. Airims Zitterpartie am Seil würde länger dauern, seine Hände klammerten sich an der Bordwand fest.
»Was … was macht ihr … argh!«
Gläser oder Flaschen zerschlugen auf dem Boden, dem ein »Du Dreckskerl!« der Frau folgte. Schnelle Schritte, die verklangen.
Und dann die Rufe des Seemanns: »Überfall! Weckt die Mannschaft!«
Airim baumelte wie ein nasser Sack vor dem Fenster. Langsam wurden seine Finger durch die Kälte steif. Seine Arme schmerzten. Er musste jetzt oder nie durch das Fenster, bevor die Seeleute von der Jagd nach den Dieben umkehrten und sich um den Kapitän kümmerten. Er hangelte sich das letzte Stück bis zum Fenster hoch.
»Aha, hab ich doch richtig gehört!«, fauchte es ihm entgegen. Airim sah einen Schatten, dann knallte ein hölzerner Belegnagel gegen seine Stirn. Das kleine Fenster verhinderte, dass der schräg geführte Schlag ihn satt erwischte. Mehr als der Schlag aber traf ihn die Erkenntnis, dass nicht nur die Diebesgilde unterwegs war. Das war nämlich kein gewöhnlicher Seemann, der ihm gerade eine verpasst hatte, denn die trugen keine so hautenge Kleidung aus schwarzem Leder.
Der Schatten verschwand so schnell, wie er aufgetaucht war. Airim pendelte einen Schritt weit weg vom Fenster, mit gestreckten Beinen hielt er sich auf Distanz. Aus der Kajüte drang das Schnarchen des Kapitäns. Vorsichtig kletterte Airim wieder hoch zum Fenster. Diesmal lugte er wie ein Kiebitz durch die kleine Öffnung. Die schwarze Gestalt wickelte einen langen Gegenstand in ein grobes Leinentuch. Airim war klar, was da sorgsam versteckt wurde. War die Diebesgilde doch nicht erfolgreich gewesen.
Airim wollte sich durch das Fenster zwängen, um den neuen Dieb seiner Beute zu berauben, als die Tür behutsam geöffnet wurde. Ein schwarzer Schatten huschte auf leisen Sohlen herein. Airim hielt den Atem an. Zwei von der Sorte, das war wirklich zu viel.
Der erste schwarze Schatten war nicht so leicht zu übertölpeln. Er sah den Eindringling und knurrte: »Ihr seid zu spät«, worauf der zweite schwarze Schatten fauchte: »Und ihr kommt hier nicht lebend raus.« Die beiden zogen ihre Dolche blank, ein munteres Geplänkel zwischen den beiden hob an, bei dem viel Schweiß und ein wenig Blut flossen und beide abwechselnd wie am Spieß »für die Schwarzen Schatten von Cuanscadan« und »für die Wahren Schwarzen Schatten von Cuanscadan« brüllten.
Nach einem mit Stöhnen und Keuchen untermalten Schlagabtausch, erarbeitete sich der erste Schwarze Schatten die bessere Position. Er schnappte sich das verschnürte Schwert, verschaffte sich mit einem beherzten Tritt in den Unterleib seines Kontrahenten Luft und hetzte aus der Kajüte. Mit einem enttäuschten Schnaufen erhob sich der zweite Schwarze Schatten. Sein schmerzverzerrtes Gesicht erübrigte die Frage, ob er an eine Verfolgung dachte.
Airim hörte ein heiseres »Na also, hab ich doch Glück« von ihm, da wurde seine Aufmerksamkeit abgelenkt. Auf dem Kai schwangen eine Handvoll Seeleute ihre Schwerter und Dolche und rannten in Richtung Hafenviertel davon. Airim zog schnell den Kopf ein, aber keiner schaute zum Schiff.
Das Gejohle entfernte sich, die Luft war wieder rein. Also auf ein Neues hochgeklettert bis zum Fenster und vorsichtig hineingespäht. In diesem Moment verschwand ein Gegenstand im Ledersack des Schwarzen Schattens. Mit wenigen Handgriffen verschnürte und schulterte der den Sack. Verstohlen schlich sich der Dieb zur Tür.
Wie ein getretener Hund jaulte Airim auf. Er war so nah am Schwert gewesen. Zu allem Überfluss stürmten die Seeleute von ihrer Jagd zurück. »Die können nicht weg sein«, krakelte einer von ihnen. Airim verwünschte diesen Tag und erst recht diese Nacht und dass er am Seil hing wie ein Fisch an der Angel. Was sollte er machen? Bevor ihn die Seeleute an der Bordwand hängen sahen, wählte er das kleinere Übel. Ein letzter Ruck, und endlich hatte er sein Ziel erreicht: die Kapitänskajüte. Müde stemmte er sich hoch. Dann glitt er wie ein nasser Sack zu Boden. Sein pfeifender Atem vermischte sich mit dem rasselnden Schnarchen des Kapitäns.
»Halt das Maul!«, raunzte er den Kapitän in seiner Koje an. Airims Augen suchten die Quelle der Schnarchgeräusche, als er an der Wand neben der Schlafstatt … Sofort war er auf den Beinen. Dort hing das Schwert von Tiaghernach. Er rieb sich verdutzt die Augen, doch das Schwert blieb wahrhaftig an Ort und Stelle.
Die Müdigkeit war mit einem Schlag wie weggeblasen. Nichts wie hin zum Schwert. Doch halt, was war das? Das Schwert – mit Smaragden und Rubinen verziert, mit Ornamenten auf der Klinge und schwungvollem Griff – verschwamm vor seinen Augen, je näher er kam. Die Konturen verschoben sich und wurden unscharf.
»Zum Kapitän!«, kam es vom Kai. Höchste Zeit, jetzt das Schwert aus seiner Halterung zu zerren. Im Nu wickelte er das Schwert in schweres Tuch, band es über seinem Rücken fest und rannte zur Tür. Die riss er auf und flitzte hinaus.
»Da ist er!«, scholl es vielstimmig von Achtern. Eine wilde Horde Seemänner mit blitzenden Klingen rauschte heran.
»Ich hasse das!«, knurrte Airim. Sechs weite Sprünge brachten ihn in Windeseile nach Backbord, mit einem Sprung stürzte er sich ins kalte Wasser. Der Runan empfing ihn mit eisigen Armen und deckte seinen klammen Mantel über ihn. Fließende Bewegungen unter Wasser trieben Airim gut zwanzig Meter von der Flaíth na Cuanscadan fort. Sein Atem wurde knapp und das Schwert schwer, und die nasse Kleidung machte jeden seiner Schwimmzüge zu einem Kraftakt. Er katapultierte sich hoch und schnappte nach Luft. Aber er hatte es geschafft. Der Nebel hatte das Schiff verschluckt, und die Rufe der Seeleute klangen gedämpft und weit entfernt.
Bevor die Besatzung eine Hetzjagd an Land starten konnte, erreichte Airim das sichere Ufer. Seine Arme zitterten von der Anstrengung der letzten Stunde. Trotzdem huschte ein Lächeln über sein Gesicht, und wenn er ehrlich war, mischte sich sogar ein klein wenig Häme ein. Er hatte allen ein Schnippchen geschlagen. Jämmerliche Diebesgilde. Unfähige Schwarze Schatten. Und dann die lächerlichen Wahren Schwarzen Schatten – alles Versager. Er pfiff vergnügt ein Lied und tänzelte mit wippenden Füßen nach Hause. Ihm würde heute Nacht niemand mehr etwas anhaben können.
* * *
»Ihr seid unglaublich!« Tarloigh hatte Mühe, seinen dicken Leib über den Tisch zu wuchten. Er klopfte Airim auf die Schulter. »Das Schwert ist schon unterwegs zum Auftraggeber, die Übergabe wird ohne Federlesen vonstatten gehen. Morgen haltet ihr eure wohlverdiente Belohnung in Händen!«
Airim setzte ein selbstgefälliges Grinsen auf: »Habt ihr etwa an mir gezweifelt? Das solltet ihr euch besser verkneifen! Und jetzt«, der junge Dieb rückte Tarloigh auf die Pelle, »verratet mir, wer euer ominöser Auftraggeber ist?«
Der Dieb stank nach billigem Fusel. Tarloigh rutschte auf Abstand. »Das ist nicht euer Geschäft, Airim, und es ist besser, ihr erfahrt niemals den Namen des Hohen Herrn. Vergesst den Auftrag. Und freut euch über die Belohnung, die ist mehr als großzügig. Seid damit zufrieden. Zum Wohl!«
Airim hatte keine andere Reaktion erwartet. Doch was ihm wichtiger war: Bald schloss er seine Einin in die Arme und führte sie aus ins Foléan Pioc, das beste Gasthaus in Cuanscadan. Und sie würde zu ihm aufsehen und zugeben müssen, dass sie beim Runenwerfen in jeder Hinsicht daneben gelegen hatte …
* * *
»Dorchan, ihr seid ein wahrer Held!«
Der Held im schwarzen Anzug saß einem Dutzend Gestalten in ebenso schwarzen Anzügen gegenüber. Zwischen ihnen prunkte auf einem roten Samtkissen eine prächtige Klinge. »Hattet ihr je Zweifel? Das verkneift euch besser.« Ein überhebliches Grinsen stach unter der Kapuze hervor.
Der erste Sprecher überging die vorlaute Bemerkung. »Das Schwert von Tighearnach ist in unseren Händen – das wird die Schwarzen Schatten wieder stark machen. Und der Fürst wird erkennen, dass seine Tage in Cuanscadan gezählt sind. Lasst uns die Becher erheben und rufen: Auf die Schwarzen Schatten! Nieder mit dem Fürsten!«
Ein Dutzend Becher wurde gleichzeitig bis auf den Grund geleert.
Nur Dorchan trank nicht bis zur Neige aus.
* * *
Das Kellergewölbe hatte schon bessere Tage gesehen. An schäbigen Tischen saßen Männer und Frauen in farbloser Kleidung. Ein spitzbübisch ausschauender Grauhaariger, offenbar nicht mehr der Jüngste, erhob sich: »Ich bewundere eure Tat, Maywen! Und deine Hilfe, Diardagh! Ihr habt uns das Schwert von Tighearnach gebracht, und wir werden diesen Schatz so lange hüten, bis der Fürst uns ein wirklich gutes Angebot macht!«
Das Schwert wurde unter dem Beifall der Anwesenden herumgereicht. Der blasse Diardagh schaute bang unter sich.
Maywen erhob sich: »Habt ihr je an meinen Fähigkeiten gezweifelt? Das werdet ihr nicht ein zweites Mal! Doch was das Angebot angeht, beanspruchen ich und Diardagh einen gehörigen Anteil vom Lösegeld. Die Hälfte, um genau zu sein.«
Die Diebe raunten entrüstet. Der Grauhaarige schaute ärgerlich auf die beiden: »Das sind Töne in der Diebesgilde, die ich nicht mehr hören möchte! Wir sprechen nachher in aller Ruhe darüber. Lasst uns jetzt auf diese große Tat die Becher heben!«
Seine Worte klangen nicht mehr so begeistert wie zu Beginn seiner Rede.
* * *
»Denen habt ihr es aber gezeigt!«, prostete die in hautenge lederne Hose und lederne Jacke gekleidete, gertenschlanke Dame einem jungen Kerl zu.
Der zwirbelte seinen eleganten Schnurrbart zwischen den behandschuhten Fingern. Eine beträchtliche Zahl an identisch aussehenden Gefährten beiderlei Geschlechts nickte zustimmend.
»Ihr habt Zweifel gehegt? Das steht euch nicht an«, knurrte der. Sein selbstsicheres Lächeln veranlasste die Dame, sich gar nicht erst auf eine Auseinandersetzung einzulassen. »Keine Zeit für Spitzen, Muiris, wir haben uns auf eine Aufgabe eingeschworen. Nichts wird die Wahren Schwarzen Schatten entzweien. Ein Auftrag, ein Weg, ein Ziel: nieder mit dem Fürsten, auf die Wahren Schwarzen Schatten!«
Alle bis auf einen stießen an.
* * *
»Mein Fürst, ihr hattet recht, die Diebesgilde hat das Schwert von Tighearnach gestohlen.«
Foineach strebte auf den Fürsten zu. Flaíth Amhairgin hatte seinen Lehnstuhl an das schmale Fenster zum Runan gerückt und starrte auf das rußfarbene Wasser. Für einen Moment verharrte Foineach. Dann wandte sich der Fürst doch seinem Getreuen zu. Seine Augen schauten farblos wie die Scheiben, in denen sich die ersten Sonnenstrahlen brachen.
»Das ist eine willkommene Nachricht!«, sagte Flaíth Amhairgin tonlos. »Da lobt mir die Weise Frau Roiscín, dass sie den neuen Täuschungszauber derart gekonnt geflochten hat! Wir sollten uns an den Zauber erinnern, wenn wir ein weiteres Mal Dinge beliebig oft nachbilden müssen. Das mag nützlich sein, wenn auch die magischen Eigenschaften bei den Imitaten verloren gehen. Doch was habt ihr noch auf dem Herzen, werter Foineach?«
»Oh, mein Fürst, nicht nur die Diebesgilde hat ein Schwert gestohlen, auch die Schwarzen Schatten waren am Werk!« Foineach stützte sich auf der Lehne des Sessels ab, der für die Fürstin reserviert war, und schnappte nach Luft. »Und das ist noch nicht alles!«
Flaíth Amhairgin runzelte die Stirn: »Ihr wollt mir doch nicht erzählen, dass drei falsche Schwerter von Tighearnach unterwegs sind?«
»Nein … oder … gewissermaßen doch. Ein drittes Schwert! Ihr erinnert euch an die Wahren Schwarzen Schatten?« Foineach druckste herum: »Auch die waren auf dem Schiff! Euer Plan ist zweifellos gelungen, Zwietracht unter den zwielichtigen Gestalten in der Stadt zu säen.«
Der Fürst nickte nur. Seine Augen folgten müde einer dicken Aasfliege, die den hellen Umhang seines Getreuen auf ihrer Wanderung mit kleinen schwarzen Punkten besprenkelte. Er räusperte sich, als Foineach zum Schlag auf das Tierchen ausholte. Der alte Mann ließ auf der Stelle davon ab.
»Drei Schwerter also. Warum auch nicht, das stiftet noch mehr Verwirrung, und die Schwarzen Schatten und die Wahren Schwarzen Schatten und die Diebesgilde und wie sie alle heißen sind fürs Erste mit sich und ihrem glanzvollen Fischzug beschäftigt!«
»Oh ja, das ist wahr, mein Fürst. Aber damit noch immer nicht genug. Ein junger Kerl … wie heißt er gleich … ach ja, Airim. Dieser Airim war ebenfalls an Bord.« Foineach verdrehte die Augen. »Ein kleiner, schmutziger Dieb, den es vom Land in die Stadt verschlagen hat und der seit einigen Monden in Cuanscadan in einem Hinterhof lebt. Für euch ist er natürlich nur ein kleiner Fisch, mein Flaíth, aber er ist anscheinend gewieft bei der Ausübung seines Handwerks und hat es schon zu etwas Ruhm in den Hafenkneipen gebracht.«
»Und was macht ein Tagedieb wie dieser Airim mit dem Schwert von Tighearnach?«, fragte der Fürst.
Foineach schüttelte den Kopf. »Verkaufen kann er das Schwert in Cuanscadan nicht. Vielleicht imponiert er damit seiner Auserwählten.«
»Behaltet ihn jedenfalls im Auge, Foineach, womöglich kann er uns eines Tages von Nutzen sein. Und nun, mein guter Freund, gebt Kapitän Brionagh endlich Bescheid, dass er das Schwert von Tighearnach an meinen Hof bringt. Aber verratet mir noch, bevor ihr davoneilt: Wo war das echte Schwert versteckt?«
Ein runzliges Lächeln huschte über das Gesicht des Vertrauten: »Der alte Kapitän hat darauf geschlafen. Ein harter Schlaf.«
»Wahrlich ein harter Schlaf – und ein hartes Stück Arbeit für alle.« Der Fürst gebot Foineach mit einem Wink, ihn nun alleine zu lassen. Dann starrte er wieder auf den Runan.
Als Foineach die Zimmertüre leise hinter sich geschlossen hatte, lächelte der Fürst.
Deireadh an scéil